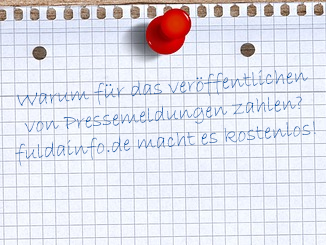Berlin. Die Mautpläne von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) gehen offenbar viel weiter als bislang bekannt: Das Bundesfinanzministerium prüft derzeit eine Änderung von Artikel 90 des Grundgesetzes über Eigentum und Verwaltung von Autobahnen und Bundesstraßen, erfuhr die „Welt“ aus Regierungskreisen. Allerdings ist das Konzept noch nicht fertig. Geht es nach den Vorstellungen des Bundesfinanzministers, passt sich die Grundgesetz-Änderung in eine europäische Investitions-Offensive zur Belebung der Konjunktur ein.
In Artikel 90 ist festgelegt, dass der Bund Eigentümer der bisherigen Reichsautobahnen und Reichsstraßen ist. Die Länder wiederum verwaltern Bundesautobahnen und sonstige Fernverkehrsstraßen im Auftrag des Bundes. Mit einer Änderung des Artikels könnte den Ländern diese Zuständigkeit entzogen werden. Die Bundesregierung wäre dann in der Lage, private Investoren hinzuziehen und diese im großen Stil daran zu beteiligen. Das wäre die Grundvoraussetzung für ein groß angelegtes Mautkonzept, das weit über bisherige Beteiligungsprojekte privater Träger an öffentlichen Investments (ÖPP) hinausgeht, heißt es. Schäuble sucht offenbar eine Möglichkeit, Milliarden für die nötigen Infrastrukturinvestitionen locker zu machen, ohne dabei im großen Stil in die Bundeskasse greifen zu müssen. Denn das würde die Neuverschuldung in die Höhe treiben. Garantierten Zinsen für Privatinvestoren steht Schäuble allerdings skeptisch gegenüber. Der Finanzminister suche nach anderen Modellen, hieß es.
Im Finanzministerium sieht man die Maut nicht als ein kurzfristiges Projekt, sondern um ein eher langfristig angelegtes Konzept. Die Pläne gehen damit deutlich über das Maut-Konzept von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hinaus. Dobrindts Maut-Pläne sehen bislang vor, nur ausländische Autofahrer mit einer Maut zu belasten. Offiziell hat sich Schäuble bislang hinter Dobrindt gestellt. Allerdings hatte der Finanzminister durchblicken lassen, die Pläne des Verkehrsministers für zu bürokratisch und europafeindlich zu halten. Dobrindts Mautpläne müssten in konstruktive Bahnen gelenkt werden, heißt es in Regierungskreisen.
IW schlägt unterschiedlich hohe Maut-Tarife für Tag und Nacht vor
Der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, schaltet sich mit einem neuen Vorschlag in die Maut-Debatte ein. In einem Gastbeitrag für „Bild“ forderte Hüther, die Höhe der Nutzungsgebühr für Autofahrer an Tageszeiten und Verkehrsdichte zu bemessen, um eine echte Lenkungswirkung zu erzielen. Demnach müssten die Maut-Tarife morgens deutlich höher liegen als nachts. „Autofahrer dürfen nicht pauschal belastet werden, sondern müssen nutzungsabhängig zahlen. Auf dem Kölner Ring würde man in der morgendlichen Rushhour mehr zahlen als nachts und am Vormittag“, erklärte Hüther. Die Gebühr müsse auch höher liegen auf zum Beispiel auf der wenig befahrenen Ostseeautobahn in Mecklenburg-Vorpommern. „Eine Lenkungswirkung entsteht, wenn Streckenabschnitte nach Staugefahr unterschiedlich hohe Preise hätten“, sagte Hüther dem Blatt. Für Berufstätige verlangte der IW-Direktor einen Maut-Rabatt: „Den Berufspendlern könnte man vergünstigte Abos anbieten, um sie nicht zu überlasten.“ Damit das Geld zielgenau auf den belasteten Straßen ankomme, sollte der Bund wie in Österreich eine Betreibergesellschaft gründen, die alle Mauteinnahmen erhält. „Anders als der Bund könnte diese Gesellschaft Projekte über mehrere Jahre planen, wodurch sie schneller und günstiger werden. Auch die Zusammenarbeit mit privaten Investoren ließe sich so steuern. Und: In jedem Fall wäre das Geld vor dem Finanzminister sicher“, sagte Hüther. +++ fuldainfo