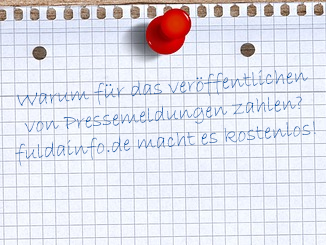Washington. Manchmal klingt es fast schon wie ein Abgesang auf die „Grand Old Party“. Während der selbstverliebte Geschäftsmann Donald Trump von Vorwahlsieg zu Vorwahlsieg eilt, lässt er die Strategen der Republikaner in einer Seelenlage zurück, die irgendwo zwischen Panik und Ratlosigkeit, zwischen Wunschdenken und Depression pendelt. Von einem Zerfall der Partei ist die Rede, von Selbstauflösung und Spaltung und der feindlichen Übernahme durch einen egozentrischen Bauunternehmer, den besagte Strategen im vergangenen Sommer allenfalls als Störfaktor empfanden. Als einen notorischen Aufschneider, der sicher schon bald über seine eigene rhetorische Plumpheit stolpern würde.
Monatelang wurde Trump unterschätzt, auch von den allermeisten Kommentatoren, den Verfasser dieser Zeilen eingeschlossen. Nun ist er kaum noch zu stoppen. Falls kein Wunder geschieht, wird er der Kandidat der Konservativen für die Nachfolge Barack Obamas. Um zu ermessen, was für ein Drama sich da gerade bei den Republikanern abspielt, sollte man einen kurzen Blick auf die personelle Vorgeschichte werfen. Seit Dwight Eisenhower 1952 das Votum gewann, haben sie keinen Kandidaten aufgeboten, der nicht zuvor in einem Wahlamt politische Erfahrung gesammelt hätte. Und Eisenhower hatte als General eine lange militärische, im Grunde politische Karriere hinter sich, schon deshalb lässt er sich mit Trump nicht vergleichen. Selbst Barry Goldwater, der erzkonservative Rebell, der 1964 im internen Wettstreit mit Nelson Rockefeller eine Säule des gemäßigten Establishments besiegte, ist zuvor eine Zeit lang Senator gewesen. Trump ist ein Neuling auf dem politischen Parkett, eine komplett unberechenbare Größe. So etwas gab es noch nie in der jüngeren Wahlgeschichte der Vereinigten Staaten.
Außerdem läuft sein Programm, sofern man bei seinen Versprechen überhaupt von einem Programm reden kann, allem zuwider, was die Republikaner an Reformbedarf für sich erkannten. Nach der Niederlage Mitt Romneys im Duell ums Weiße Haus rieten ihre klügeren Köpfe dringend dazu, sich der Realität der Vereinigten Staaten anzupassen, vor allem der Wirklichkeit des demografischen Wandels. Stellten weiße Amerikaner 1980 noch 91 Prozent der Stimmberechtigten, so waren es 2012 nur noch 72 Prozent, und im Herbst 2016 werden es 68 Prozent sein. Zu alt, zu männlich, zu weiß sei die Partei, hieß es nach Romneys Schlappe. Mit einer Sprache, die Hispanics, Afroamerikaner und Immigranten asiatischer Herkunft weitgehend ausgrenze, lasse sich kein Blumentopf mehr gewinnen. Und nun kommt Trump, spricht vom Mauerbau an der Grenze zu Mexiko, verklärt das alte, unangefochten von Weißen beherrschte Amerika, bedient sich unterschwelliger Ressentiments und stößt die ethnischen Minderheiten damit noch mehr vor den Kopf. In den Augen der Parteistrategen kann es nur auf eine Niederlage im Wahlfinale hinauslaufen. Nur scheint es inzwischen zu spät, den Zug noch anzuhalten, so die Lausitzer Rundschau. +++ fuldainfo