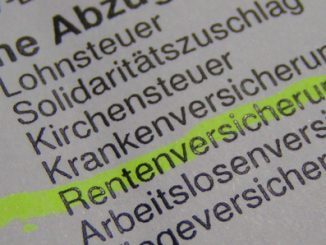„Der überwiegende Teil der Bevölkerung in Deutschland wünscht sich, die letzte Lebensphase im familiären, häuslichen Umfeld zu verbringen. Im Gegensatz zu dieser Vorstellung erlebt ein Großteil der Betroffenen seine letzten Tage in stationären Einrichtungen, in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Hospizen. Zusätzlich zu dieser physisch und psychisch nicht unerheblichen Belastung wird ein beträchtlicher Anteil sterbender Heimbewohner und Krankenhauspatienten in ihren letzten Tagen nochmals in ein weiteres Versorgungsumfeld verlegt“, heißt es auf der Internetpräsenz des Forschungsprojektes „Avenue-Pal“. Und weiter: „Aus dieser bis heute weitgehend unreflektierten Praxis ergeben sich rechtliche und ethische Fragestellungen, signifikante Kosteneffekte und insbesondere erhebliche Beeinträchtigungen in der Versorgungs- und Lebensqualität der Sterbenden. Diese Problematik greift das Forschungsprojekt Avenue-Pal, die ‚Analyse und Verbesserung des sektoren- und bereichsübergreifenden Schnittstellen- und Verlegungsmanagement in der Palliativversorgung‘, auf. Im Rahmen dieses Projektes wurden unter Federführung des TransMIT-Projektbereiches für Versorgungsforschung, unter Beratung und Leitung durch Prof. Dr. Wolfgang George, sowie in Kooperation mit namhaften Projektpartnern zwei evidenzbasierte Leitlinien – für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen – entwickelt, um nicht notwendige Verlegungen palliativ versorgter Menschen in Zukunft zu verhindern.“
Rund 200 Teilnehmer unterschiedlichster Berufsgruppen, Regionen und Bundesländer fanden sich kürzlich beim Regionalkongress zum Projekt „Avenue-Pal“ auf einer virtuellen Plattform zusammen, um die Ergebnisse aus dem vom Gemeinsamen Bundesausschuss geförderten Projekt zu diskutieren. Im Rahmen des Kongresses stand die Versorgung Sterbender im Zentrum. Bereits in den verschiedenen Eröffnungsstatements wurde die durch die Corona-Pandemie ausgelöste Tagesaktualität unterstrichen. „In Belastungssituationen, wie denen der Corona Pandemie, spürt man, ob die Versorgungsstrukturen gut funktionieren.“, brachte es der Schirmherr der Veranstaltung, Kanzleramtsminister Prof. Helge Braun, auf den Punkt. In seiner Anmoderation betonte der Projektleiter Prof. George: „Gerade aufgrund der Corona-Erfahrungen sind regionale Gesundheitsgenossenschaften Zukunftsformat, die Menschen mitzunehmen.“ Prof. Reimer Gronemeyer, Theologe und Soziologe, führte diskursiv in die grundsätzlich zu beantwortenden Fragen ein, nach dem Umgang mit dem Alter und alten Menschen und dem hiermit verbundenen gesellschaftlichen Wertekanon. Die zentrale Botschaft Gronemeyers an die Kongressteilnehmer lautete: „Soziale Teilhabe bis zuletzt, ist keine technokratische Aufgabe, die vor allem in der Hand von Profis liegt, sondern eine Aufgabe, die Sorge, Empathie, ja im Grunde Liebe braucht.“
Die Westersteder Bürgermeister Michael Rösner und Bürgermeister a. D. Klaus Groß zeichneten in ihrem Vortrag den Weg nach, den „ihre Stadt“ hin zur „Gesundheitsstadt“ seit vielen Jahren beschreitet. Die Situation der Einbindung und Unterstützung alter Menschen – und dabei auch die Beachtung deren letzten Lebensabschnitte – ergebe sich logisch, wenn nur die Gesunderhaltung und bestmögliche Versorgung aller Bürger das Ziel einer beständigen Gemeinde- bzw. Städtepolitik sei. Hierbei käme der Patientenverfügung eine besondere Rolle bei. In dem Referat von Dr. Thomas Sitte (Vorstandsvorsitzender der Deutschen PalliativStiftung) und Prof. Wolfgang George (THM, Gießen) wurde ein für die Gemeinden und Städte entwickelter Leitfaden vorgestellt, unter dessen Anwendung – so die Referenten – es zur wirkungsvollen Stabilisierung der Betreuung von sterbenden Menschen kommt. Und dies ganz unabhängig von deren Sterbeort: Altenpflegeeinrichtung, Krankenhaus oder auch in der häuslichen Versorgung. Der Gemeinde kommt dabei als Schlüsselfunktion eine wichtige moderierend-koordinierende, letztlich integrierende Funktion zu. Noch immer gebe es zu häufig ein „nebeneinanderher,“ könnten soziale, medizinisch-pflegerische, professionelle und nicht professionelle Unterstützer besser kooperieren. Für diese vernetzende Funktion wäre die offizielle Bestellung eines Hospiz- und Palliativbeauftragten ausgesprochen hilfreich. Prof. Ulf Sibelius (Universitätsklinikum Gießen Marburg, Gießen) berichtete über das Potenzial eines palliativen Konsiliardienstes. Als dezentrale Form der Mitversorgung könne ein solcher Dienst dazu beitragen, dass krankenhausinterne Verlegungen, die nicht angezeigt oder gewünscht sind, weitestgehend vermieden werden. Zudem würden Patientinnen und Patienten, aber auch Angehörige, frühzeitig und vorausschauend in die Versorgungsplanung eingebunden. Dies schaffe für alle Beteiligten erhöhte Sicherheit und Orientierung.
Der Geschäftsführer der AWO in Gießen Jens Dapper resümierte seine Erfahrungen: „Pflegeheime, mit ihren vielfältigen Angeboten zur Betreuung der älteren Bevölkerung, fügen sich als eines der wichtigen Versorgungszentren in die Strukturen der Kommunen ein. Vorausschauende Planung und Teilhabe auch in den spätesten Phasen des Lebens – nicht nur in Heimen – trägt somit aktiv zu einem gelungenen, emotional belegten bürgernahen Miteinander bei.“ Prof. Thomas Schanze (THM, Gießen) beschrieb den im Zuge des Projektes entwickelten Prototypen einer App, der pflegende Angehörige bzw. die Familien der Betroffenen, entlasten soll. Dies gelänge über eine systematische Ausweitung und Unterstützung der Kompetenzen der Anwender. Auch würden die entstehenden Informationen den Anwendern gehören. Technik müsse den Nutzen des einzelnen Menschen und damit der Bürger in den Vordergrund stellen. Gerade in dieser schweren Situation. In den Aussprachen und Diskussionen betonte der wissenschaftliche Projektleiter und Moderator Prof. George die Bedeutung einer gelungenen Kooperation aller an der Versorgung Beteiligter! Hierfür würden die Integrierten Versorgungsverträge bis heute die geeignetste Form darstellen, um dies im Gesundheitswesen zu ermöglichen. Bisher versäumt worden wäre es, weitere Sozialpartner, die Kommune aber auch die Interessen der Bürger unmittelbar einzubinden. Ein Defizit, das etwa in einer regionalen Gesundheitsgenossenschaft überwunden werden könnte. +++ pm/ja