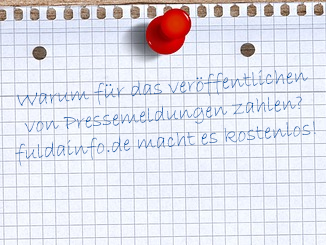Berlin. Deutschland hat den Mindestlohn eingeführt. Ein Erfolg, den sich die Arbeitnehmervertreter auf die Fahnen schreiben. Doch der Deutsche Gewerkschaftsbund hadert mit Details des Gesetzes, vor allem mit den Ausnahmeregelungen. Stefan Körzell, Mitglied des Geschäftsführenden DGB-Bundesvorstandes, sieht aber noch etliche andere Baustellen – etwa die Themen Leiharbeit und Werkverträge, aber auch den Ausbildungsmarkt.
Wo es starke Tarifpartner gibt, muss der Staat nicht eingreifen. Ist der gesetzliche Mindestlohn Ausdruck von Schwäche der Gewerkschaften?
Stefan Körzell: Nein. Es sind doch die Arbeitgeber, die sich falsch verhalten haben. Sie haben massiv Tarifflucht begangen. Sie sind aus den Arbeitgeberverbänden ausgetreten und haben eine neue Mitgliedschaft begründet, nämlich die Mitgliedschaft ohne Tarifbindung. Das hat zu einer Erosion von Flächentarifverträgen geführt. Deswegen ist der gesetzliche Mindestlohn als Lohnanstandsgrenze nötig geworden. Dennoch reden wir auch über Bereiche, in denen wir Schwierigkeiten haben, uns als Gewerkschaften zu organisieren.
Der DGB verliert seit zwei Jahrzehnten Mitglieder…
Körzell: Uns ist in den vergangenen zwei Jahren eine Trendwende gelungen. Wir haben mittlerweile fünf Gewerkschaften, die am Jahresende 2013 ein Plus verzeichnen konnten. Sie dürfen auch nicht vergessen, dass wir nach der Wiedervereinigung einen hohen Anstieg hatten. Später haben sich die Mitgliederzahlen dann ein Stück weit eingependelt. In den ostdeutschen Ländern erleben wir derzeit, dass der Organisationsgrad wieder steigt.
Nun hat Deutschland den Mindestlohn. Wie zufrieden sind sie mit dem schwarz-roten Kompromiss?
Körzell: Zunächst einmal ist der Mindestlohn ein großer Erfolg für die Gewerkschaften, der sich auch auszahlen wird. Wir haben insgesamt zehn Jahre massiv dafür gekämpft. Gegen große Widerstände in der Politik, aber auch in der Öffentlichkeit. Am Ende der Kampagne und mit der Verabschiedung des Mindestlohns waren laut Umfragen weit über 80 Prozent der Bundesbürger dafür, dass es einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn gibt. Natürlich werden wir auch in Zukunft Tarifverträge abschließen. Der Mindestlohn ersetzt diese nicht. Die Große Koalition hat mit dem Gesetz auch eine Erleichterung von Allgemeinverbindlichkeitserklärungen verabschiedet. Dies werden wir nutzen. Gerade hat das Bundeskabinett den Mindestlohn für die Fleischindustrie zum 1. Januar 2015 auf den Weg gebracht. Im Gartenbau und in der Landwirtschaft haben wir mittlerweile auch Tarifverträge, im Friseurhandwerk ebenfalls. Allein die Aussicht auf die Verabschiedung des Mindestlohngesetzes hat dazu geführt, dass die Arbeitgeber sich auf die Gewerkschaften zubewegt haben, um mit ihnen Tarifverträge abzuschließen.
Dennoch lässt das Gesetz aus Ihrer Sicht zu viele Ausnahmen zu.
Körzell: Wir sind der Meinung, dass man für Jugendliche unter 18 Jahren und auch für Langzeitarbeitslose keine Ausnahmen machen sollte. Die Begründung dafür ist doch schlicht falsch: Wenn der Mindestlohn wirklich ein Hemmnis wäre, um in den Arbeitsmarkt zu gelangen, dann hätten ja in der Zeit, als es noch keinen Mindestlohn gab, alle Langzeitarbeitslosen Beschäftigung finden müssen. Das war nicht der Fall. Es gibt auch kein anderes europäisches Land, das eine solche Regelung hat.
Sie kritisieren auch die Übergangsfrist für die Zeitungszusteller. Sehen Sie nicht die Gefahr, dass ein Mindestlohn in ländlichen Regionen dazu führt, dass dieser Beruf dort ganz verschwindet und durch das E-Paper ersetzt wird oder dass die Scheinselbstständigkeit zunimmt?
Körzell: Fest steht, dass die Zeitungsbranche ein umkämpfter Markt ist. Es findet ein Konzentrationsprozess statt und es gibt starke Konkurrenz durch die neuen Medien. Aber der Mindestlohn wird nicht zu einer riesigen Kostenlawine führen. Die Gewerkschaft ver.di hat errechnet, dass der Mindestlohn jede ausgetragene Zeitung um etwa drei Cent teurer macht. Das Bild vom massenhaften Zeitungssterben, das in diesem Zusammenhang gezeichnet wird, ist ein Märchen.
Der Mindestlohn soll alle paar Jahre nachjustiert, also erhöht werden. Schwächt das die Position der Gewerkschaften in Tarifverhandlungen?
Körzell: Wir haben mit der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände vereinbart, dass es eine nachlaufende Erhöhung des Mindestlohns gibt – und zwar alle zwei Jahre. Ein Indikator für die Entwicklung des Mindestlohnes werden Daten des Statistischen Bundesamtes zur Erhöhung der Tarifentgelte sein, die üblicherweise im Februar veröffentlicht werden. Wir werden in der Mindestlohnkommission aber keine Diskussion über regionale Unterschiede führen. Dass mit der Mindestlohnfestsetzung im Verfahren der nachlaufenden Erhöhung auch Signale gesetzt werden für die kommenden Tarifverhandlungen, schließe ich aus.
Die Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, den Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen durch strengere Regeln einzudämmen. Wie müssen die konkret aussehen?
Körzell: Bei den Werkverträgen ist das größte Problem, dass sie in Deutschland nicht erfasst werden. In Österreich ist das anders. Dort werden Werkverträge auch über die Arbeitsverwaltung erfasst. Hierzulande gibt es nur Schätzungen über den Umfang. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) geht davon aus, dass wir rund 650 000 Werkvertragsarbeitnehmer haben. Wir wollen, dass die Betriebsräte mitbestimmen, wenn es um den Einsatz von Werkvertragsarbeiternehmern geht. Außerdem muss kontrolliert werden, ob es auch tatsächlich Werkvertragsarbeitnehmer im Sinne des Gesetzes sind, die von den Unternehmen als solche eingesetzt werden. Auch bei der Leiharbeit brauchen wir eine stärkere Regulierung und eine Eindämmung. Gibt es doch zahlreiche Unternehmen, in denen Leiharbeit nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel ist. Wir halten eine Höchstverleihdauer von 18 Monaten, wie sie die Große Koalition will, für zu lang.
In manchen Konzernen macht der Anteil mehr als 20 Prozent der Belegschaft aus. Warum ist die zunehmende Leiharbeit für Arbeitgeber eigentlich so attraktiv für Unternehmen?
Körzell: Sogar OP-Schwestern und Ärzte werden mittlerweile als Leiharbeitskräfte beschäftigt. Leiharbeitnehmer werden in den Firmen nicht als Personalkosten geführt. Sie werden eingekauft wie Schrauben und somit als Sachkosten verbucht. Die Unternehmen versprechen sich davon höhere Flexibilität, sie können auf Marktschwankungen schneller reagieren und müssen sich nicht um den Kündigungsschutz kümmern. Manchmal sind Leiharbeiter auch billiger als das Stammpersonal. Ein Geschäftsmodell für die Zukunft kann und darf das nicht sein – gerade angesichts des demografischen Wandels. Selbst die Personaldienstleister haben inzwischen Schwierigkeiten, qualifizierte Leute zu finden, die sie verleihen können.
Bundesweit sind noch rund 160 000 Lehrstellen unbesetzt. Woran liegt das?
Körzell: Da müssen Sie genau hinsehen, welche Lehrstellen unbesetzt sind, an welchem Ort und wie attraktiv die Arbeitgeber sind.
Was schlagen Sie denn vor, damit mehr junge Menschen Koch, Bäcker oder Kellner werden?
Körzell: Da müssen sich die Arbeitgeber in bestimmten Branchen fragen, ob sie denn selbst ausbildungsreif sind. Sie sollten sich fragen, welches Bild sie nach außen vermitteln. Dass ein Bäcker oder eine Servicekraft in der Gastronomie nicht morgens um acht Uhr anfängt und um 16 Uhr Feierabend hat, weiß jeder. Aber wenn die Arbeitsbedingungen ungünstig sind, dann muss die Entlohnung eben attraktiv sein. Und es dürfen keine ausbildungsfremden Arbeiten erledigt werden.
Gleichzeitig wirft der Nationale Bildungsbericht den Betrieben einen hausgemachten Fachkräftemangel vor, weil zu wenig ausgebildet wird. Wie passt das zu der – nicht nur in diesem Jahr – hohen Zahl der offenen Lehrstellen?
Körzell: Die Ausbildungsquote liegt derzeit bei 21,3 Prozent. Also nicht mal ein Viertel der Betriebe, die ausbilden könnten, tun dies auch. Aber alle Betriebe wollen Fachkräfte. Das kann nicht funktionieren. Zudem darf man sich nicht immer nur die Besten aussuchen, man muss sich auch wieder den Schwächeren zuwenden, denen man mit betriebsbegleitendem Unterricht helfen kann, erfolgreich eine Ausbildung abzuschließen.
Das Thema Inklusion ist in der Wirtschaft offenbar noch nicht richtig angekommen. Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung zufolge finden von 50 000 behinderten Jugendlichen nur 3500 einen betrieblichen Ausbildungsplatz. Woran liegt das?
Körzell: Möglicherweise gibt es da noch Barrieren, die abgebaut werden müssen. Wir wissen, dass manche Betriebe lieber die Abgabe zahlen, als einen Schwerbehinderten einzustellen. Grundsätzlich denke ich, dass wir uns in den vergangenen Jahren zu sehr daran gewöhnt haben, immer nur die Besten herauszupicken. Wir als DGB machen uns für die sogenannte assistierte Ausbildung stark. Dabei werden Jugendliche nicht nur auf ihrem Weg in, sondern auch durch die Ausbildung hindurch persönlich und fachlich begleitet. Diese Aufgabe übernehmen Bildungsträger als Dienstleister. Wenn wir wissen, dass wir auf einen Fachkräftemangel zusteuern, dann müssen wir jetzt die Weichen stellen – und auch Geld investieren.
Das Gespräch führte Klaus Bohlmann von der Landeszeitung Lüneburg. +++ fuldainfo