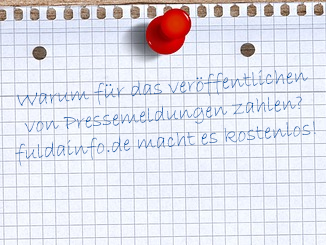Umweltprobleme machen nicht vor Grenzen halt. Die unterschiedlichen Interessen zum Schutz von Erde, Wasser und Luft unter einen Hut zu bringen, ist allerdings alles andere als einfach. Das weiß man nicht erst seit den spürbaren Auswirkungen des Klimawandels. Wie schwierig sich solche Verhandlungen im Kalten Krieg gestalteten, zeigte Sophie Lange im Rahmen ihres Vortrages in der Gedenkstätte Point Alpha auf. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Zentrums für Zeithistorische Forschung Potsdam nahm die „deutsch-deutsche Umweltpolitik“ in den Fokus und zeichnete ein Bild von den damaligen Unwägbarkeiten zwischen planwirtschaftlicher Diktatur und marktwirtschaftlicher Demokratie.
Etwa 90 Prozent der Flüsse flossen von Ost- nach Westdeutschland. So überquert beispielsweise die Werra mehrmals die innerdeutsche Grenze zwischen Hessen und Thüringen. Der Fluss war zeitweise doppelt so salzhaltig wie die Nordsee, denn Kaliwerke in Hessen wie auch Thüringen führten salzhaltige Lauge in den Strom ab. Die ökologischen Folgen waren auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs verheerend. „Das Bewusstsein für den Schutz von Natur und Umwelt entwickelte sich allmählich. Der Druck von Umweltverbänden nahm zu. Es musste etwas passieren. Und nicht nur auf diesem Feld“, verdeutlichte Sophie Lange auf Point Alpha. Denn die Bundesrepublik entsorgte ihren Müll inklusive giftiger Abfälle auf Deponien südlich von Berlin in der DDR. Von der Luftverschmutzung waren beide Staaten annähernd gleich betroffen. Rauchgase und Staub nicht nur aus den Schloten der Kohlekraftwerke wurden hüben wie drüben als Gefahr für die Gesundheit und den Planeten identifiziert. Das Waldsterben und das hochbelastete Chemiedreieck Leuna-Schkopau-Bitterfeld zwangen zum Umdenken.
Als das Thema Umweltschutz Anfang der 1970er-Jahre aufkam und sich die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der DDR im Zuge der „Neuen Ostpolitik“ entspannten, stand damit auch das Thema „Umweltschutz“ auf der gemeinsamen Agenda. Das erste Gespräch fand am 29. November 1973 statt – nach Aussagen der Zeitgenossen in einer sehr aufgeschlossenen und gelösten Atmosphäre. Was dann aber bei den unzähligen Treffen und Verhandlungen folgte, war doch eher komplex, kompliziert und zäh. Es wurde um Begriffe und Definitionen sowie um Technik und Finanzierung gerungen und nationale und internationale Befindlichkeiten entpuppten sich als Bremsklötze. Ökonomische und politische Spannungen führten zu harten Rückschlägen. Immerhin: Man blieb in Kontakt. Insgesamt 15 lange Jahre hatte die Umweltdiplomatie bei den Informations- und Erfahrungsaustauschen zu kämpfen bis es 1987 dann doch zu einer gemeinsamen Umweltvereinbarung kam.
In der anschließenden Diskussion mit den Zuschauern im Haus auf der Grenze wurde deutlich, dass vermeintlich kleine, lokale Umweltproblematiken im Grenzbereich der Rhön zwischen dem Landkreis Fulda und dem heutigen Wartburgkreis auf der höheren Politikebene keine Rolle spielten. Die Auswirkungen von den großen, stinkenden Gülleseen der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG), von Herbiziden, die per Hubschrauber verspritzt wurden, oder das großflächige Entfernen von Feldgehölzen wurden als weniger brisant eingestuft und vermutlich in den Grenzkommissionen behandelt. Mit der Friedlichen Revolution und dem Ende der DDR wurden die Umweltfragen an den Wiedervereinigungsprozess weitergereicht. Schließlich wurde 1994 der Umweltschutz als Ziel für den gesamtdeutschen Staat in das Grundgesetz aufgenommen. Obwohl sich die Luft- und Wasserqualität inzwischen hauptsächlich durch den Austausch veralteter Technologien oder die Stilllegung von Fabriken verbesserte, sind einige Umweltprobleme wie die Werraversalzung oder die Diskussionen um die Mülldeponien bis heute ungelöst und stellen somit auch in Zukunft gemeinsame Herausforderungen für das vereinte Deutschland dar. +++ pm