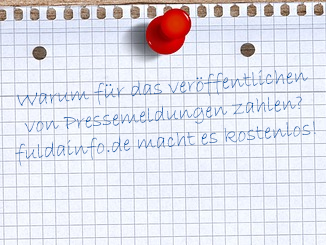Die Kommunen in Deutschland blicken zunehmend besorgt auf ihre eigene Finanzsituation. Mit 58 Prozent bewertet laut dem am Donnerstag veröffentlichten KfW-Kommunalpanel 2024 mehr als die Hälfte von ihnen diese als negativ. Das sind knapp zehn Prozentpunkte mehr als im Vorjahr.
Zu einer positiven Einschätzung der Finanzlage kommen derzeit nur noch 17 Prozent der befragten Kommunen – ein Minus von sechs Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Noch pessimistischer ist der Ausblick der Kämmereien auf die kommenden fünf Jahre. Neben den aktuellen fiskalischen Herausforderungen wie schwächerem Steuerwachstum, steigenden Personalausgaben und zunehmenden Sachaufwendungen infolge höherer Preise oder zusätzlicher sozialer Aufgaben kommen auf die Kommunen strukturelle Herausforderungen zu: Klimaschutz und -anpassung, Digitalisierung oder Demografie machen erhebliche Mehrinvestitionen erforderlich. Angesichts der engen kommunalen Haushaltsspielräume erwarten nur noch zwei Prozent der Kommunen eine positive Entwicklung ihrer Finanzlage in den nächsten fünf Jahren, die große Mehrheit von 88 Prozent schaut eher negativ in die nahe Zukunft.
Die Sorge ist, dass diese schlechten Erwartungen der Kämmereien über kurz oder lang zu niedrigeren Investitionen führen. Für das aktuelle Jahr rechnen die Kommunen aber mit Gesamtinvestitionen von 45 Milliarden Euro in ihren Kernhaushalten. Insgesamt legen die Investitionsplanungen damit um 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu, gleichen aber die Preissteigerungen im Bausektor nicht aus. Wichtigste Investitionsschwerpunkte bleiben mit knapp 13 Milliarden Euro die Schulen, gefolgt von knapp elf Milliarden Euro für die Straßen. Mit Abstand folgen die Kinderbetreuung sowie der Brand- und Katastrophenschutz mit jeweils rund vier Milliarden Euro. Für die öffentlichen Verwaltungsgebäude werden nur etwas mehr als drei Milliarden Euro eingeplant.
Die steigenden Preise führten zuletzt zusammen mit weiter zunehmenden Anforderungen an die kommunale Infrastruktur in der bundesweiten Hochrechnung zu einem Anstieg des wahrgenommenen Investitionsrückstands der Kommunen auf insgesamt 186,1 Milliarden Euro. Das entspricht 20,5 Milliarden Euro bzw. 12,4 Prozent mehr als im Vorjahr und wird im Wesentlichen durch die Investitionsbereiche Straßen (+ 9,7 Milliarden Euro auf 48,3 Milliarden Euro), Schulen (+ 7,3 Milliarden Euro auf 54,8 Milliarden Euro) sowie Brand- und Katastrophenschutz (+ 4,0 Milliarden Euro auf 16,3 Milliarden Euro) getrieben. Weitere größere Blöcke des Investitionsrückstands stellen Verwaltungsgebäude mit 18,8 Milliarden Euro, Kitas mit 12,7 Milliarden Euro und Sportstätten mit 12,1 Milliarden Euro dar.
Verschiedene Hemmnisse stehen einer Steigerung der kommunalen Investitionstätigkeit im Wege oder verzögern die Umsetzung von Investitionen. Die Hemmnisse wirken dabei sehr unterschiedlich. So sorgen fehlende Finanzmittel (bei 55 Prozent der Kommunen) oder unpassende Fördermittelangebote (43 Prozent) vor allem dafür, dass Projekte gar nicht oder nur in abgespeckter Form durchgeführt werden. Hingegen führen komplexe und zeitaufwändige Verfahren und Vorgaben in rund 60 Prozent der Kommunen zu einer Verzögerung von mehr als einem Jahr. Auch die Liefer- und Kapazitätsengpässe der Bauwirtschaft führen bei über 60 Prozent zu einer Verzögerung und in rund der Hälfte der Kommunen auch zu einer Verteuerung von mehr als 25 Prozent gegenüber den ursprünglich angesetzten Kosten.
Personalmangel in der Bauverwaltung wiederum führt in 56 Prozent der betroffenen Kommunen zu deutlichen Verzögerungen und in fast 30 Prozent der Fälle sogar dazu, dass Projekte gar nicht durchgeführt werden. Die Vielzahl an Hemmnissen erfordert verschiedene Lösungsansätze, beispielsweise Vereinfachungen der Vorschriften und Abbau der Bürokratie, eine Stärkung der Verwaltungskapazitäten, insbesondere durch die Digitalisierung von Prozessen, aber auch eine verbesserte finanzielle Basis für die kommunalen Investitionen.
Wie die Kommunen ihre Investitionen finanzieren, hat sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. Eigenmittel machen rund die Hälfte im Finanzierungsmix aus, während sich die andere Hälfte weitgehend aus Fördermitteln (22 Prozent) sowie Kommunalkrediten (24 Prozent) zusammensetzt. Angesichts der sich verengenden Haushaltsspielräume erwartet jede zweite Kommune eine steigende Bedeutung der Kreditfinanzierung. Dies fällt in einen Zeitraum deutlich gestiegener Zinsen. Rund 40 Prozent der Kommunen, die einen Kredit in Anspruch genommen haben, empfanden die Konditionen der Kreditaufnahme im vergangenen Jahr als eher oder sehr schlecht. Für das kommende Jahr bleibt der überwiegende Teil der Kommunen mit Blick auf die Kreditkonditionen pessimistisch.
Die Verwaltungsgebäude von Kommunen sind häufig modernisierungsbedürftig und machen den drittgrößten Block im Investitionsrückstand aus, genießen jedoch nur geringe Priorität bei der kommunalen Investitionstätigkeit. Ein zeitgemäßer Zustand der Verwaltungsgebäude erscheint jedoch aus verschiedenen Gründen erforderlich: So sehen zum Beispiel 81 Prozent der Kommunen einen Zusammenhang zwischen dem Zustand der Rathäuser und dem Eindruck, den Bürger vom Staat haben.
„Die anhaltenden Krisen und wirtschaftliche Unsicherheiten hinterlassen ihre Spuren in der Stimmung der Kreise, Städte und Gemeinden: Neun von zehn Kommunen blicken pessimistisch auf die Entwicklung ihrer Finanzlage in den kommenden fünf Jahren. Gleichzeitig wächst der wahrgenommene Investitionsrückstand auf über 186 Milliarden Euro an“, sagte Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW.
„Damit die Kommunen ihren Beitrag zur Daseinsvorsorge und Transformation leisten können, sind Investitionen allerdings zentral. Dabei ist auch wichtig, sich klarzumachen, dass die Kommunen rund 60 Prozent der Baumaßnahmen der öffentlichen Hand tätigen. Hier gilt es in Zeiten knapper Finanzmittel auch die vielen nicht-monetären Hemmnisse anzugehen, beispielsweise durch vereinfachte Genehmigungs- und Vergabeverfahren, damit zumindest die vorhandenen Investitionsmittel schneller und effizienter verbaut werden können.“ +++