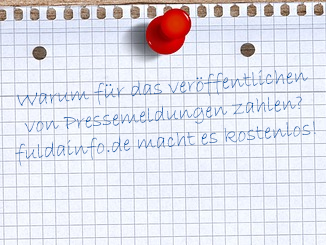Berlin. Die Jamaika-Koalitionäre haben eine politische Leiche wieder ausgegraben: die Begrenzung der Sozialabgaben auf unter 40 %. Nein, im Sondierungsstand der CDU/CSU, FDP und Grünen zu den Themen Arbeit, Rente, Gesundheit, Pflege und Soziales vom 30. Oktober 2017 wird das Limit von 40 % für Sozialausgaben nicht als zu klärende Frage aufgelistet. Es ist ein politisches Ziel, auf das man sich offenbar ebenso schnell einigen konnte wie auf die „schwarze Null“ beim Haushalt. Es ist genauso schwachsinnig wie das Mantra der CSU von der Obergrenze für Zuwanderungen und Asylsuchende.
Für die Grünen war die Senkung der Sozialabgaben schon in der von ihnen mit gestalteten Agenda 2010 ein zentrales Anliegen, das sie mit der bizarren Parole „Lohnnebenkosten runter, Öko-Steuer rauf“ propagierten. Als ob man die Energiewende über sinkende Sozialversicherungsbeiträge finanzieren könnte! Es muss auch das tiefe Geheimnis der Grünen bleiben, wie man die Begrenzung der Sozialabgaben mit dem von ihnen versprochenen flächendeckenden Ausbau der Versorgung von Pflegebedürftigen, einer besseren Bezahlung der Pflegekräfte und einer wirksamen Bekämpfung der Altersarmut in Einklang bringen kann. Das alles ist ohne eine Aufstockung des Sozialbudgets nicht zu haben. Das wäre auch kein wirkliches ökonomisches Problem, wie die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten gezeigt hat. Der BIP-Anteil des Sozialbudgets lag 1970 bei 20,2 % und stieg kontinuierlich bis 2015 auf 29,4 %. Dieser Zuwachs widerlegt die gängige Behauptung, steigende Sozialausgaben schädigten die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Für diese Behauptung gab es noch nie eine belastbare Begründung. Bekennende Gegner eines expandierenden Sozialbudgets wie Heike Göbel, Leiterin der FAZ-Wirtschaftsredaktion, stehen vor einem Rätsel: „Der deutsche Sozialstaat wächst und wächst, trotzdem feiern deutsche Unternehmen Exporterfolge.“
Marktliberale tun sich grundsätzlich mit der Sozialpolitik schwer. Sie sei mit Umverteilung und Zwang verbunden, also mit dem Gegenteil liberaler Politik, so Heike Göbel. Zwar nimmt sie zur Kenntnis, dass der Sozialstaat eine hohe Akzeptanz bei den Bürgern und eine demokratische Legitimation hat. Aber man müsse seinen Ausbau mit einer „Sozialbremse“ an das Wirtschaftswachstum koppeln. Auch sollten sozialpolitisch motivierte Eingriffe in den Wettbewerb wie Mietpreisbremse, Mindestlohn oder Deckelung der Energiepreise unterbleiben. Diese seltsame ordnungspolitische Kombination aus Rasenmäherprinzip und freier Marktwirtschaft würde die Sozialausgaben nicht senken, sondern eher steigern. Ohne einen angemessenen Mindestlohn oder eine wirksame Mietpreisbremse wachsen die Anforderungen an das Sozialbudget, weil Erwerbstätige der Niedriglohngruppen von ihrem Arbeitseinkommen nicht mehr leben bzw. ihre Miete nicht mehr zahlen können und bei den zuständigen Institutionen Lohnaufstockungen bzw. Wohngeld beantragen müssen. Sogar das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft fordert wegen der steigenden Mieten eine Anhebung des Wohngeldes. Diesen Entwicklungen mit einer „Sozialbremse“ begegnen zu wollen, zeugt von einem Realitätsverlust, der entsteht, wenn man der marktliberalen Ideologie aufsitzt. Das Postulat einer „Sozialbremse“ ist Ausdruck einer Ignoranz gegenüber sozioökonomischen Prozessen, die der Kapitalismus selbst nolens volens hervorbringt, aber mit seinen eigenen marktwirtschaftlichen Instrumenten nicht bewältigen kann.
Der Kapitalismus hat zur wachsenden Individualisierung und Destruktion von traditionellen Gemeinschaften und Familienverbünden geführt, die früher soziale Aufgaben für ihre Angehörigen ohne Bezahlung wahrnahmen. An ihre Stelle traten öffentlich finanzierte Formen der kollektiven Daseinsfürsorge, ohne die auch die kapitalistische Wirtschaft nicht vernünftig funktionieren kann. Der Sozialstaat ist sowohl Produkt als auch Existenzbedingung des Kapitalismus. Der Ökonom Eduard Heimann hat diesen dialektischen Widerspruch schon 1929 in seinem auch heute noch lesenswerten Traktat „Soziale Theorie des Kapitalismus“ dargestellt. Demnach erreicht Sozialpolitik „immer dann und nur dann einen Erfolg, wenn die Erfüllung einer sozialen Teilforderung zur produktionstechnischen Notwendigkeit wird.“ Der Sozialstaat schützt nicht nur die Lohnabhängigen, sondern auch den Kapitalismus selbst vor seinen suizidalen Eigenschaften und reduziert so seinen ökonomischen Herrschaftsbereich. Zu ähnlichen Erkenntnissen kamen vor 70 Jahren auch Joseph Schumpeter und Karl Polanyi in ihren Klassikern „Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie“ bzw. „The Great Transformation“.
Daher sind etwa die Einführung der sozialen Pflegeversicherung und die flächendeckende Versorgung mit Kindertagesstätten keine verzichtbaren Wohltaten, sondern das Ergebnis der demografischen Entwicklung, der Anforderungen des Arbeitsmarktes und der Gleichberechtigung der Geschlechter. Der Ausbau sozialer Dienste ist nicht zuletzt eine Konsequenz der wachsenden Berufstätigkeit von Frauen, die nicht mehr wie früher für unbezahlte Arbeit in der Erziehung, im Haushalt und in der Pflege von Familienmitgliedern zur Verfügung stehen. Es geht in der Sozialpolitik nicht nur um den versicherungstechnischen Schutz vor allgemeinen Lebensrisiken, sondern auch um die Sicherung des ökonomischen Reproduktionsprozesses und die Teilhabe aller Bürger am sozialen Leben. Den mit der wirtschaftlichen Entwicklung steigenden Bedarf an sozialen Diensten und der Absicherung allgemeiner Lebensrisiken kann nur der Staat angemessen befriedigen. Nur er kann in den damit verbundenen Verteilungskonflikten entscheiden sowie umfassende und weitgehend krisenfeste Risikogemeinschaften mit einer langen Lebensdauer bilden. Sogar neoklassische Ökonomen wie Kenneth Arrow („Social Choice and Individual Values“) kamen schon vor 50 Jahren zu dem Schluss, dass der Staat mehr Sicherheit bietet, weil er größere Risikogemeinschaften bilden kann als private Versicherungsunternehmen.
Die entscheidende Frage ist also nicht, ob wir uns ein wachsendes Sozialbudget leisten können, sondern wie es sozial gerecht finanziert werden kann. Hier ist eine zu Lasten der unteren und mittleren Einkommen gehende Schieflage entstanden. Die Vorstellung, der Sozialstaat finanziere sich durch eine Umverteilung von den höheren zu den niedrigeren Einkommen, ist ein verbreiteter Irrtum. Die schließende Schere in der Verteilung der Arbeitseinkommen hat für die Finanzierung der Sozialversicherung fatale Konsequenzen. Die unteren und mittleren Einkommensgruppen sind die Hauptfinanziers des Sozialbudgets. Dafür sorgen die Versicherungspflicht- und Beitragsmessungsgrenzen. Allein die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung (ab 2018: 4.800 Euro pro Monat) auf das in der Rentenversicherung geltende Niveau (West: 6.500 Euro, Ost: 5.800 Euro) könnte die Sozialversicherungsabgaben um bis zu drei Prozentpunkte senken, wenn alle Erwerbstätigen Pflichtmitglieder der GKV wären.
Das käme vor allem den unteren Einkommensgruppen zugute, die weniger durch die Lohnsteuer als durch Sozialabgaben belastet werden. Aber auch die Arbeitgeber würden in Form sinkender Sozialabgaben davon profitieren. Wenn die Grünen denn unbedingt die Sozialabgaben auf unter 40 % des Bruttolohnes senken wollen, sollten sie sich an ihr eigenes Parteiprogramm halten und die schrittweise Einführung einer Bürgerversicherung fordern. Aber dieses Ziel haben sie offenbar schon bei Aufnahme der Jamaika-Sondierungen aufgegeben. +++ Von Hartmut Reiners /makroskop.eu